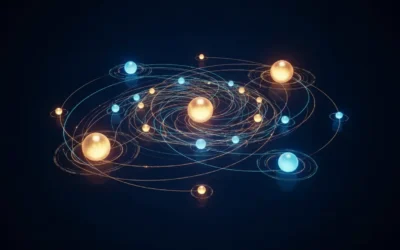Ein Impuls aus der Unternehmenswelt: Dieser Artikel richtet sich primär an Führungskräfte und Entscheider. Die hier beschriebenen Prinzipien zu Resilienz, Kommunikation und Verantwortung lassen sich jedoch oft auch auf persönliche Herausforderungen übertragen. Für mehr tiefgehende Inhalte aus der Welt der Organisations- und Führungskräfteentwicklung besuche gerne Businesstraining . Vision
Organisatorische Veränderungen fordern Menschen mental, emotional und sozial. Eine aktuelle Originalstudie in Frontiers in Psychology untersucht präzise, wie Mitarbeitende ihre persönliche und kollektive Arbeitsidentität erleben, wenn eine wesentliche Veränderung bevorsteht. Ein Geschäftsbereich eines Edelstahl-Herstellers wird ausgegliedert. Es entstehen ein neues Managementsystem, ein neuer Markenauftritt und ein neuer Firmenname. Genau diese Konstellation ist ein Realexperiment für Identität im Wandel. Damit liefert die Studie hochrelevante Erkenntnisse für Change-Management, Mentalcoaching und Führungspraxis.
Warum diese Studie wichtig ist
Arbeitsidentität beschreibt, wer wir bei der Arbeit sind. Persönlich als individuelles Selbst und kollektiv als Wir-Gefühl mit Team oder Organisation. Beide Ebenen bestehen aus emotionalen und kognitiven Komponenten. Emotional meint Gefühle wie Stolz, Verbundenheit, Kränkbarkeit. Kognitiv meint Denken, Erinnern, Einordnen und Selbstzuschreibungen. Veränderungen können diese Identitätsanker stärken, irritieren oder spalten. Das Verständnis dieser Mechanismen entscheidet über Akzeptanz, Widerstand, psychische Belastung und Performance.
Studiendesign in Kürze
- Ansatz. Theoriegeleitete, deduktive, qualitative Thematic Analysis auf Basis von vier vorab definierten Themen. 1) Persönliche emotionale Arbeitsidentität. 2) Persönliche kognitive Arbeitsidentität. 3) Kollektive emotionale Arbeitsidentität. 4) Kollektive kognitive Arbeitsidentität.
- Datenerhebung. Halbstrukturierte Telefoninterviews.
- Stichprobe. Sieben Mitarbeitende eines schwedischen Edelstahlunternehmens. Vier White-Collar, drei Blue-Collar. Durchschnittsalter 51 Jahre. Ø Betriebszugehörigkeit 20 Jahre.
- Kontext. Pre-Change-Phase. Die Veränderung stand kurz bevor. Die Antworten spiegeln Identität direkt vor der Umsetzung.
Zentrale Ergebnisse. Was Mitarbeitende wirklich erleben
1) Persönliche emotionale Arbeitsidentität. Stolz, Verbundenheit, Vermissen
- Stolz. Viele erlebten klaren, unmissverständlichen Berufs- und Tätigkeitsstolz. Dieser wurzelt in Kompetenz, Erfahrung und dem Wunsch, gute Arbeit zu leisten. Manche formulierten es nüchterner als Pflichtbewusstsein.
- Verbundenheit und Vertrautheit. Freude an der Arbeit entsteht stark über soziale Faktoren. Zusammenarbeit, Teamzusammenhalt, gebraucht werden, Aufgabenvielfalt.
- Vermissen. Fehlte die Arbeit, fehlten oft vor allem die Kolleginnen und Kollegen. Zudem wurden Kontrolle, Sicherheit, Entwicklung und Tagesroutinen vermisst.
- Praxisrelevanz. Starke persönliche emotionale Bindungen sind psychologische Ressourcen. Sie fördern intrinsische Motivation, mentale Gesundheit und eine positive Change-Orientierung, wenn der Wandel nachvollziehbar bleibt.
2) Persönliche kognitive Arbeitsidentität. Kohärenz, Korrespondenz, Reflexion und mentale Zeitreisen
- Kohärenz. Die Arbeit prägt das Selbstbild und die Art zu denken und zu handeln. Verantwortung und Vertrauen ließen die Befragten wachsen. Arbeit wird zu einem wesentlichen Teil der eigenen Lebensgeschichte.
- Korrespondenz. Die direkte Übertragung ins Privatleben war oft nur schwach ausgeprägt. Einzelne Kompetenzen, etwa Menschenkenntnis, wurden jedoch als hilfreich erlebt.
- Reflexion und mentale Zeitreisen. Viele dachten auch außerhalb der Arbeitszeit intensiv über Arbeit nach – über Aufgaben, Verbesserungen im Team oder sie arbeiteten trotz Krankheit von zu Hause. Das wurde teils als mental fordernd erlebt.
- Praxisrelevanz. Eine starke kognitive Bindung erhöht das gedankliche Arbeitspensum. In Change-Phasen kann das zu mehr Stressreaktionen führen. Führung und Mentalcoaching sollten gedankliche Grenzziehung, Erholungsfähigkeit und Reframing stärken.
3) Kollektive emotionale Arbeitsidentität. Organisationsansehen, Stolz, Kränkbarkeit
- Organisationsansehen. Lob von außen wurde meist positiv registriert. Es wurde jedoch selten als persönliches Kompliment erlebt.
- Stolz und affektive Bindung. Schmähungen der Organisation lösten bei einigen deutlichen persönlichen Affekt aus. Bis zum Vergleich mit der Beleidigung eines Familienmitglieds. Andere reagierten kontextabhängig oder ambivalent.
- Praxisrelevanz. Unterschiedliche emotionale Kopplungen an die Organisation erzeugen unterschiedliche Change-Reaktionen. Hohe affektive Bindung kann motivieren. Sie kann aber bei als ungerecht erlebtem Wandel Widerstand und Verletzlichkeit verstärken.
4) Kollektive kognitive Arbeitsidentität. „Wir“-Sprechen, Assimilation, Inkorporation
- Identifikation. Alle sprachen selbstverständlich von „wir“. Ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zur Organisation war kognitiv klar vorhanden.
- Assimilation. Unternehmenserfolg verbesserte Klima und Atmosphäre. Er wurde aber selten als persönlicher Erfolg internalisiert.
- Inkorporation. Der gute Ruf nach außen war wichtig, primär aus Markt- und Kontextgründen.
- Praxisrelevanz. Kognitiv starkes „Wir“ bei gleichzeitig zurückhaltender persönlicher Erfolgsinternalisierung ist ambivalent. Es kann Bereitschaft fördern, wenn der Wandel als organisationsdienlich erscheint. Es kann Widerstand schüren, wenn das „Wir“ den Change als Bedrohung des In-Groupselbsts interpretiert.
Übersetzung in die Praxis. Change-Management trifft Mentalcoaching
Aus der Rolle als Change-Management- und Mentalcoaching-Experte ist klar. Identität ist der Schlüsselhebel im Wandel. Die Studie belegt eine komplexe Matrix. Stark versus ambivalent. Emotional versus kognitiv. Persönlich versus kollektiv. Daraus folgen konkrete Strategien.
1) Identitätsdiagnostik vor dem Change
- Führen Sie kurze, strukturierte Fokusinterviews oder Pulse-Surveys zu Identitätsdimensionen durch. Persönlich-emotional, persönlich-kognitiv, kollektiv-emotional, kollektiv-kognitiv.
- Nutzen Sie Leitfragen.
- Wofür sind Sie in Ihrer Arbeit besonders stolz?
- Wann fühlen Sie sich am stärksten als Teil eines „Wir“?
- Wie oft beschäftigen Sie sich in der Freizeit gedanklich mit Arbeit?
- Was macht den Ruf der Organisation für Sie persönlich bedeutsam?
- Ergebnis. Ein Identitätsprofil pro Team. Grundlage für passgenaue Kommunikation, Beteiligung und Entlastung.
2) Kommunikationsarchitektur identitätsbasiert designen
- Für starke persönliche emotionale Bindungen. Sinn, Beitrag, Kontinuität hervorheben. Zeigen, was bleibt und welches „Warum“ verbindet.
- Für starke persönliche kognitive Bindungen. Klarheit und Struktur schaffen. Zeitlinien, Rollen, Zuständigkeiten, Arbeitslast, Erholungsfenster. Proaktives Erwartungsmanagement senkt Grübelzeit.
- Für starkes kollektives „Wir“. Bedrohungsreduktion. Stellen Sie Ingroup-Kontinuität sicher. Symbole, Rituale, Teamnamen, Leitwerte, die mitgehen.
- Für ambivalente kollektive Bindungen. Konkreter Nutzen im Alltag. Teamautonomie, Prozessverbesserungen, schnell sichtbare Quick Wins.
3) Beteiligungsdesign. Vom Betroffenen zum Beteiligten
- Co-Creation-Formate. Change-Canvas-Workshops auf Teamebene. Welche Routinen bleiben, welche verändern wir, welche schaffen wir neu.
- Rollen für Identitätsanker. Kultur- und Lernbotschafterinnen im Team. Mentale Sicherheit fördern.
- Feedback-Loops. Zweiwöchentliche Kurzschleifen mit Entscheidungsrückmeldungen. Sichtbare Responsivität baut Vertrauen auf.
4) Mentale Schutzfaktoren systematisch stärken
- Boundary-Management trainieren. Abschalt-Routinen, Micro-Recovery, klare End-of-Work-Rituale.
- Kognitive Entlastung. Externe Speichersysteme, Timeboxing, Fokusfenster, Reframing bei Unsicherheit.
- Emotionsregulation. Atemtechniken, 3-Minuten-Reset, Kurzvisualisierungen.
- Selbstwirksamkeit. Win-Logs, Transfer von Stärken, lösungsfokussierte Selbstgespräche.
- Teamresilienz. Gemeinsame Rituale, Peersupport, psychologische Sicherheit, Reduktion von Schuldzuschreibungen.
5) Narrative und Symbole als Brückenbauer
- Erzählen Sie die Veränderung als Entwicklungsgeschichte, nicht als Bruch. „Von. Über. Zu.“ Woher kommen wir? Was lernen wir? Wozu befähigt uns das?
- Bewahren Sie Identitätsmarker. Was bleibt gleich. Werte, Qualitätsverständnis, Team-Spirit.
- Nutzen Sie starke Bilder. „Neues Trikot. Gleiche Mannschaft. Klareres Spielsystem.“ Das reduziert Bedrohung und erhöht Handlungsorientierung.
6) Gerechtigkeit aktiv gestalten
- Prozedural. Transparentes Vorgehen, klare Kriterien, faire Beteiligung.
- Distributiv. Ausgewogene Lasten und Nutzen.
- Interaktional. Respektvolle, wertschätzende Kommunikation.
- Warum. Hohe kollektive Identifikation reagiert besonders sensibel auf wahrgenommene Ungerechtigkeit. Das kann zu Enttäuschung und Vergeltungsimpulsen führen. Vorbeugen ist günstiger als heilen.
Mentale Mikrowerkzeuge für den Alltag im Wandel
- 90-Sekunden Atemfokus. 4 Sekunden einatmen, 4 halten, 6 ausatmen. Dreimal wiederholen. Senkt arousal, stärkt kognitive Flexibilität.
- 2-Minuten Cognitive Offload. Alle unbeantworteten Gedanken stichwortartig notieren. Nächster Mini-Schritt definieren. Kalendertermin setzen.
- Reframing-Frage. „Worüber habe ich heute Kontrolle, Einfluss oder Akzeptanz? Was ist mein 1 Prozent Fortschritt?“
- Team-Check-In. Drei Skalen 0–10. Energie, Fokus, Klarheit. Maximal zwei konkrete Maßnahmen zur Erhöhung um einen Punkt vereinbaren.
- End-of-Work-Ritual. Drei erledigte Dinge notieren. Eine Sache für morgen festlegen. Arbeitsplatz physisch ordnen. Abschließen.
Was Führung jetzt konkret tun sollte
- Identität sichtbar machen. Visualisieren Sie pro Team die stärksten Bindungen und die größten Ambivalenzen.
- Doppelstrategie fahren. Stabilisieren, was Identität stützt. Strukturieren, was kognitiv überlädt.
- Tempo dosieren. Erst psychologische Sicherheit, dann Performanceambition steigern.
- Erfolge sofort markieren. Klein anfangen, früh würdigen, sichtbar machen.
- Mentalkompetenz professionalisieren. Führung und Teams in Resilienz, Boundary-Management, Selbstführung und Kommunikationshandwerk schulen.
Fazit für Praxis, Coaching und Change
Identität ist der Resonanzboden jeder Veränderung. Die Studie zeigt klar. Mitarbeitende tragen zugleich klare und ambivalente emotionale und kognitive Bindungen. Persönlich und kollektiv. Wer diese Matrix erkennt und respektvoll adressiert, reduziert Widerstand, stärkt Sinn, entlastet mental und erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit von Transformationen. Für Mentalcoaching heißt das. Ressourcen sichern, Grenzen trainieren, Selbstwirksamkeit erhöhen und Teamresonanz gezielt aufbauen. Für Change-Leadership heißt das. Identitätsdiagnostik, gerechte Prozesse, transparente Kommunikation und beteiligungsorientiertes Design. So wird Wandel nicht zur Bedrohung der Identität. Er wird zum nächsten Kapitel einer glaubwürdigen gemeinsamen Geschichte.
Quellenangabe
Nordhall O, Hörvallius J, Nedelius M and Knez I (2025) Employees‘ experiences of personal and collective work-identity in the context of an organizational change. Front. Psychol. 16:1382271. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1382271
Michael Deutschmann, MSc
Zert. Change-Manager, Akad. Mentalcoach & Supervisor
Persönlichkeits-, Team- & Organisationsentwicklung
6432 Sautens | Dorfstraße 88
Ötztal | Tirol
Mental Austria – Mentalcoaching & Supervision
Psychologische Beratung – Psychosoziale Beratung
Businesstraining . Vision Michael Deutschmann KG
Unternehmensberatung
Herzliche Grüße
Michael Deutschmann, MSc
Akad. Mentalcoach & Supervisor